![]()
|
Hirnforscher
beweisen: Erkenntnis macht Lust, Lernen ist sexy.
Nur
in der Schule ist die Neurodidaktik noch nicht angekommen
von
Ulrich Schnabel ***
Lernen ist
wie Sex. Sagt die Hirnforschung. Aber das glaubt natürlich keiner.
Lernen gilt als saure Pflicht, öde und nervtötend. Dabei könnte
nichts weiter von der Wirklichkeit entfernt sein: Erstens ist der Trieb
nach Erkenntnis mit dem Sexualtrieb durchaus vergleichbar, woraus zweitens
folgt, dass Lernen sexy ist, was drittens erklärt, warum unser Gehirn
nichts lieber tut als eben das: lernen.
Aber die
Pisa-Studie, der Schulfrust, die Bildungsmisere? Kommen später. Zunächst
einmal zeichnet sich Homo sapiens vor allen anderen Spezies durch eine
besondere Fähigkeit aus: seine fast unendliche Lernfähigkeit.
Erst der Drang, immer Neues zu entdecken, zu verstehen und aus Fehlern
zu lernen, verhalf unserer Gattung zu ihrem evolutionären Siegeszug
auf diesem Planeten.
Den entscheidenden
Kick, glaubt der emeritierte Tübinger Hirnforscher Valentin Braitenberg,
habe dem Menschen das Glücksgefühl seiner „Aha-Erlebnisse“ gegeben.
Zusätzlich zu den natürlichen Trieben wie Essen oder Fortpflanzung
habe die Natur den Homo sapiens mit einem „Kapiertrieb“ ausgestattet, der
uns Lust daran empfinden lässt, Einzelheiten zu einem Ganzen zu fügen
und neue Verknüpfungen zu erkennen – sei es die Pointe eines Witzes
oder die Erkenntnis eines mathematischen Theorems.
Braitenberg
ist überzeugt, dass „beim Menschen, und nur bei ihm, die Verknüpfung
der Vorstellungen zu Gedankenketten oftmals auf das eine Ziel hin gerichtet
ist, diese Hirnlust zu erleben“. Dass dieser Trieb so stark ist, erklärt
der Hirnforscher so: Offenbar ist in der grauen Vorgeschichte der Menschheit
eine Art Kurzschluss im Hirn entstanden, irgendwo zwischen einem Kontrollorgan,
das Gehirninhalte ordnet, und einem Zentrum, in dem Schlüsselreize
eines animalischen Triebs angesiedelt sind. „Die Vermutung liegt nahe“,
sagt Braitenberg, „dass es sich dabei um das Sexualzentrum handelt.“
Klingt gewagt? Weil Sex nur Lust erzeugt und Lernen vor allem anstrengend
ist? Weit gefehlt. „Auch sexuelle Aktivität ist anstrengend“, gibt
der amerikanische Hirnforscher John Gottman zu bedenken. Aber da beide
Tätigkeiten wichtig für den Fortbestand unserer Gattung seien,
würden sowohl beim Sex als auch beim (erfolgreichen) Lernen Botenstoffe
im Gehirn ausgeschüttet, die das körpereigene Belohnungszentrum
anregten. „Eine neue Stadt zu entdecken, eine neue Sprache zu lernen, das
löst ein ähnliches Gefühl aus wie die Einnahme von Kokain“,
schwärmt Gottmann.
In Deutschland verbreitet diese Botschaft derzeit vor allem der Lernforscher
Henning Scheich, Direktor am Leibniz-Institut für Neurobiologie in
Magdeburg. Er hat den „Glückseffekt“ beim Lernen direkt gemessen –
wenn auch nur in Versuchen an Wüstenrennmäusen: Dabei setzt er
den Käfigboden der Nager unter Strom und lässt kurz zuvor einen
elektronischen Pieps ertönen. Bald haben alle Mäuse die Lektion
gelernt: Wer beim Erklingen des Warntons in die Luft springt, entgeht dem
unangenehmen
Kitzelreiz.
Und genau dieser Lernfortschritt (und nicht etwa das simple Abschalten
des Elektroschocks), das zeigen Scheichs Untersuchungen, führt im
Hirn der Mäuse zur Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. „Selbstständig
eine Lösung zu finden bereitet ihnen offensichtlich ungeheure Lust“,
sagt der Hirnforscher über seine Zöglinge.
Doch Henning Scheich bleibt bei der Maus nicht stehen. Der Neurobiologe
ist überzeugt, dass die grundlegenden Lernmechanismen bei Nager und
Mensch dieselben sind. Daher hat er aus seinen Ergebnissen bereits „biologische
Thesen zum optimalen Lernen“ destilliert, die, so fordert er, künftig
in der Pädagogik mehr Beachtung finden müssten. Wer von der Arbeitsweise
des Gehirns nichts verstehe, hätte „keine Ahnung davon, wie Kinder
am besten lernen“, meint Scheich.
Auch andere Neurobiologen haben mittlerweile die Lernforschung entdeckt
und glauben, dass die Schulen ohne ihre Erkenntnisse künftig nicht
mehr auskommen. Die Hirnforschung sei für das Lernen so wichtig „wie
die Muskel- und Gelenkphysiologie für den Sport“, schreibt der Psychiater
und Mediziner Manfred Spitzer in seinem soeben erschienenen Buch Lernen
(Spektrum Verlag), das den Kenntnisstand zum Thema dokumentiert.
Schon kursiert der Begriff der Neurodidaktik, und mancher von der Pisa-Studie
verunsicherte Bildungspolitiker mag gar glauben, darin so etwas wie ein
Zaubermittel gegen die deutsche Bildungsmisere zu entdecken. Doch bei aller
Faszination für die Neuroforschung: Erkenntnisse aus Ratten- und Mäuseversuchen
sind nur bedingt auf den Schulalltag übertragbar. „Ganz gewiss lässt
sich kein Schulsystem direkt aus der Gehirnforschung ableiten“, räumt
Manfred Spitzer ein. Zudem hapert es in deutschen Klassenzimmern häufig
an viel mehr als nur an den richtigen Kenntnissen in Neurobiologie – an
verbindlichen Standards, den nötigen Mitteln und nicht zuletzt auch
an der Professionalisierung der Lehrer.
Darüber hinaus liefert die Hirnforschung, bei Licht betrachtet, oft
nicht viel mehr als eine Bestätigung alter, längst bekannter
pädagogischer Weisheiten: Dass Lernen mit Lust verknüpft ist
und emotional gefärbte Erlebnisse besser als neutrale erinnert werden,
erkannte schon vor über 300 Jahren der Verfasser der Didactica Magna,
Jan Amos Comenius. „Alles, was beim Lernen Freude macht, unterstützt
das Gedächtnis“, brachte Comenius die spätere Erkenntnis der
Neurodidaktik auf den Punkt.
Und die scheinbar moderne Einsicht, dass Informationen dann am besten verarbeitet
werden, wenn sie auf möglichst vielfältige Weise – gesungen,
gereimt, gemalt – den Wahrnehmungsapparat anregen, entspricht just der
Maxime von Heinrich Pestalozzi (1746 bis 1827), eine gute Erziehung müsse
„mit Kopf, Herz und Hand“ erfolgen. Selbst die wichtigste Botschaft der
frühkindlichen Forschung – dass in den ersten Lebensjahren die Grundlagen
für spätere Lernerfolge gelegt werden und bestimmte „Entwicklungsfenster“
des Lernens sich irgendwann schließen – plappert schon der Volksmund
mit seinem „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ daher.
Die Neurodidaktiker selbst geben auch gar nicht vor, Brandneues zu präsentieren.
„Wir müssen zu den pädagogischen Klassikern wie Comenius, Pestalozzi
oder Montessori zurück“, sagt Henning Scheich. Und der Mathematiker
Gerhard Friedrich aus Lahr, deutschlandweit der erste Habilitand im Fach
Neurodidaktik, ergänzt: „Was könnte eine neurobiologisch fundierte
Erziehungswissenschaft denn auch anderes liefern als eine Bestätigung
,guter‘ Pädagogik?“ Die Neurobiologie steuere dazu nur endlich eine
„materiell begründbare Basis“ bei.
Vor allem aber räumt die Hirnforschung mit dem Irrglauben auf, wir
müssten uns zum Lernen zwingen. Im Gegenteil: Unser Gehirn lernt immerzu,
ob wir wollen oder nicht. Wer es nicht glaubt, wird von allen Babys eines
Besseren belehrt. Sie beweisen, dass Lernen kinderleicht ist: Von Anfang
an erforschen sie die Welt, üben sich unermüdlich im Laufen,
Sprechen oder Nervensägen – und haben ganz offensichtlich Spaß
daran. Und warum sind Babys wahre Meister des Lernens? „Weil wir noch keine
Chance hatten, es ihnen abzugewöhnen“, antwortet der Psychologe Manfred
Spitzer lapidar.
Wie erzeugt man Hunger?
Für
ihn ist die Frage nach der fehlenden Motivation meist völlig falsch
gestellt. „Menschen sind von Natur aus motiviert, sie können gar nicht
anders, denn sie haben ein äußerst effektives System hierfür
im Gehirn eingebaut.“ Die Frage, wie man Menschen motiviere, sei etwa so
sinnvoll wie die Frage: Wie erzeugt man Hunger? Die einzig vernünftige
Antwort laute: Gar nicht, denn er stellt sich von allein ein. In Wahrheit
gehe es bei der Motivationserzeugung letztlich immer um Probleme, „die
jemand damit hat, dass ein anderer nicht das tun will, was er selbst will“.
Die richtige Frage laute also nicht: Wie motivieren? Sondern: Warum sind
so viele Menschen häufig demotiviert? Und da entdeckt Spitzer ein
ganzes Arsenal von „Demotivationskampagnen“ unserer Gesellschaft – wie
etwa die Ausschreibung von Preisen, die stets nur den Besten (die kein
Motivationsproblem haben) verliehen werden und alle anderen Bewerber demotivieren.
Was sich in den Schulen ändern müsste, um den Erkenntnissen der
Neurodidakten gerecht zu werden, ist also häufig genau das, was weitsichtige
Pädagogen wie etwa Hartmut von Hentig seit Jahrzehnten predigen: den
Schülern nicht möglichst viel Stoff eintrichtern wollen, sondern
sie zum eigenen Problemlösen anregen (nur dies aktiviert schließlich
das Belohnungszentrum); sie im Selbstversuch die Grenzen von Erfolg und
Misserfolg ausloten lassen (auch Sex erfährt man nur durch aktives
Tun, nicht durch Zuschauen); besonderes Gewicht auf die frühe Förderung
im Vor- und Grundschulalter legen (wenn Lernstrategien ausgebildet werden);
klare Standards und Grenzen setzen (die Orientierung erlauben) und darauf
achten, dass die Gehirne nicht mit zu vielen Reizen überflutet werden
(Computerspiele).
Vor allem aber, und das ist vielleicht die wichtigste Folgerung aus der
Hirnforschung, sollten wir endlich akzeptieren, dass kein Gehirn dem anderen
gleicht und Menschen – auch in ihrem Lernverhalten – höchst individuell
sind. So hat die Neurobiologie gezeigt, dass die „Zeitfenster“ für
wichtige Fertigkeiten wie Laufen, Sprachenlernen oder Musizieren von Kind
zu Kind ganz verschieden sein können. Just diese Erkenntnis – und
die darauf basierende individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers
– ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Ländern wie Finnland, die im
Pisa-Test besonders gut abschnitten.
Dass dies auch in Deutschland geht, demonstrieren die Bielefelder Laborschule
oder die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden, die ebenfalls beste Pisa-Noten
erhielten.
Wirklich neu ist übrigens auch diese Erkenntnis nicht. Schon der kürzlich
verstorbene Begründer der Kybernetik, Heinz von Foerster, hatte erkannt:
„Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein
Gesicht oder ein Fingerabdruck – und noch individueller als das Liebesleben.“
So gesehen ist Lernen sogar noch aufregender als Sex.
© (2002)Ulrich Schnabel
Kommentar
schreiben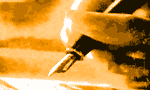
***
Ich bedanke mich herzlich bei Ulrich Schnabel, für die Genehmigung
seinen Artikel im Salon im Net aufnehmen zu dürfen
und bei Ruth Viebrock von "Die Zeit", die den Kontakt hergestellt hat.
Weitere Artikel zum Thema: Wie die Welt in den Kopf kommt
Das menschliche
Gehirn kann gar nicht anders. Es lernt permanent.
Wie die
Lust am lernen wächst (und was dies für die Erziehung ihrer Kinder
bedeutet),
erzählt
die amerikanische Neurobiologin Lise
Eliot.
Was uns
zum Lernen motiviert, erklärt der Psychologe Jürgen
Beckmann.
Um die
Welt zu verstehen, sind auch die Träume wichtig: Ohne das Lernen im
Schlaf versagt unsere Erinnerung.
Beobachtungen
von Christoph Drössler.
Neurobiologen
erkunden Lernbiografien: Wie werden Babys zu Forschern, von Donata
Elschenbroich.
Was macht
das Lernen im Alter zum Abenteuer.
Bei alten
Menschen schwindet die rasche Auffassungsgabe.
Dafür
wächst die Weisheit, von Sabine
Etzold.
Informationen zur Lernforschung unter: WWW.ZEI.DE/2002/48/LERNEN