

Ich bedanke mich für die freundliche Genehmigung, von Jens Jessen, seinen Artikel im Salon im Net, abbilden zu dürfen.
Danke auch an Frau Viebrock, die den Kontakt hergestellt hat.
Salon im Net, den
16. Febraur 2004
ein Online Projekt
von Ilona Duerkop
 |

Ich bedanke mich für die freundliche Genehmigung, von Jens Jessen, seinen Artikel im Salon im Net, abbilden zu dürfen. Danke auch an Frau Viebrock, die den Kontakt hergestellt hat. |
Die hilflosen Missionare
Demokratie und Kapitalismus lassen sich zwar exportieren. Aber an der Kultur der fremden Länder könnte die Modernisierung scheitern
Jede Debatte hat ihren blinden Fleck. Im Streit um den Irak-Krieg ist alles Mögliche umgewälzt worden, nur eine Frage wurde niemals gestellt: ob nämlich die Demokratie, wenn sie überhaupt durch Krieg eingeführt werden kann, den Irak tatsächlich friedlicher, zumindest weniger bedrohlich machen und der westlichen Lebensart näher rücken werde.
Augenscheinlich ist dies eine Annahme, die uns so selbstverständlich erscheint, dass wir sie nicht mehr diskutieren: dass es im Leben der Völker bestimmende Kräfte gibt, die allen anderen Kräften ihren Charakter aufprägen. Zu den bestimmenden Kräften rechnen wir offenbar die Politik. Ändert sich die Regierungsform, erwarten wir auch einen Wandel der Kultur. Von einem demokratischen Irak nehmen wir an, dass er Toleranz, Pluralismus, eine Abneigung gegen Märtyrertum, Terrorismus und andere Formen von Fanatismus erzeugen werde. Mehr noch, wir erwarten sogar die Emanzipation der Frau und die Liberalisierung der Märkte.
Aber warum? Weil im Westen die Demokratie zusammen mit diesen kulturellen und wirtschaftlichen Haltungen auftritt und wir offensichtlich der Meinung sind, dass Kultur und Wirtschaft der politischen Vorgabe folgen. Eine andere, nicht weniger verbreitete Meinung setzt voraus, dass die Wirtschaft die entscheidende Kraft ist, und, wenn einmal die Weichen für Privateigentum, Handel und Kapital gestellt sind, Demokratie und Pluralismus von selbst hinterherpurzeln. Nicht verbreitet dagegen scheint der Gedanke, dass alle diese Erscheinungen sich nebeneinanderher entwickelt haben und nur historisch zufällig in der zeitgenössischen Gesellschaft des Westens gemeinsam auftreten.
Und noch viel ferner liegt uns die Vorstellung, dass die Hierarchie sich vielleicht umdrehen ließe und nicht Politik oder Wirtschaft die bestimmende Kraft sei, sondern die Kultur. Offenbar sind wir längst alle Vulgärmarxisten geworden und denken, dass Kultur, verstanden als Reich der Sitten, Bräuche und Gedanken, eine Sache des Überbaus ist, der zu einer gegebenen politischen und wirtschaftlichen Situation einfach hinzugebastelt werde.
Dafür gibt es auch gute Gründe, zu denen vor allem der Optimismus des Machbaren gehört. Denn Politik lässt sich ändern; Wirtschaft, mit etwas mehr Mühe, auch. Aber was sich nicht oder jedenfalls nicht schnell ändern lässt, ist die Kultur, unsere Neigung, Brötchen zum Frühstück zu essen, Sinfoniekonzerte zu hören oder Religion als Privatsache zu betrachten. Gewohnheiten und Einstellungen dieser Art sind in Jahrhunderten gewachsen und werden sich, aller Voraussicht nach, auch nur über Generationen hinweg wandeln. Sollte Kultur das Vorgängige sein und Wirtschaft oder Politik die Folgephänomene, dann müsste man für eine Verwestlichung des Iraks schwarz sehen.
Der Omnibus, ein Hinduschrein
Das hieße nicht, dass Demokratisierung unmöglich wäre. Es hieße schon gar nicht, dass Demokratie und bürgerliche Freiheiten von Irakern oder Muslimen nicht gewünscht würden. Es hieße aber, dass mit ihrer Einführung keineswegs der Weg zur westlichen Lebensform beschritten würde. Es wäre durchaus denkbar, dass die Religion ihren verpflichtenden Charakter behielte, sogar in Formen einer Staatskirche. Es wäre genauso denkbar, dass Frauen weiterhin von vielen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen blieben, möglicherweise sogar mit ihrer Billigung. Denkbar wäre auch, dass Israel von frei und geheim gewählten Abgeordneten als Staatsfeind Nummer eins bekräftigt würde; sogar dass ein Projekt zur Finanzierung und Ausbildung von Selbstmordattentätern von einem Parlamentsausschuss beschlossen würde. Nur Träumer können glauben, dass demokratisch legitimierter Terrorismus unmöglich wäre.
Mit anderen Worten: Wenn das für Westler Unausdenkliche der Fall wäre und die Kultur die geheime Herrscherin der Gesellschaft ist, dann gäbe es nicht die geringste Garantie für eine Entwicklung des Iraks in die von uns gewünschte Richtung. Nicht die neu eingeführte Politik würde die Kultur modellieren, sondern die längst eingeführte Kultur würde sich die Politik zurichten. Es würde der schönen, neuen Westdemokratie vielleicht ergehen wie jenen Omnibussen, die in Indien nach westlichen Blaupausen gebaut, dann aber von ihren Eignern so lange mit Farben, Amuletten, Seidentroddeln, Spiegelscherben, Büffelhörnern bearbeitet werden, bis sie eher an einen Hinduschrein erinnern.
Wenn es wirklich nur um Demokratisierung ginge, müssten und könnten wir das hinnehmen; wir könnten und müssten uns auch fragen, ob wir nicht ebenfalls die antike Idee der Demokratie so lange kulturell bearbeitet haben, bis sie sich in etwas verwandelte, was unserem Sinn für sozialen Ausgleich entspricht, nämlich eher an einen korporatistischen Ständestaat erinnert. Aber tatsächlich ging es im Irak nicht um die Staatsform. Nicht die Diktatur hat uns gestört; Diktaturen waren in anderen Teilen der Welt willkommen, man denke nur an die eigens von den USA installierten Regime in Chile oder Argentinien.
Das, was uns in der islamischen Welt feindselig gegenübersteht, ist die Kultur – nicht einmal die Religion, sondern das, was kulturelle Überformung aus dem Islam gemacht hat. Zur Kultur gehören der ressentimentbeladene Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen, die Verehrung der Gewalt, die Sehnsucht nach dem Martyrium, die Gängelung der Frau und die Herrschaft der Patriarchen. Was wir bearbeiten, das heißt in unserem Sinne zivilisieren wollen, ist die Kultur, und nur das Instrument dazu ist die Demokratie.
Das wahre Ziel heißt Umerziehung; man könnte auch sagen: Anpassung. Wenn aber die Umerziehung nicht durch Politikexport gelingt – was dann? Dann bliebe nur der Weg der Kolonialisierung. Es ist dem amerikanischen Publizisten David Rieff zu danken, dass er den Begriff in die Debatte geworfen hat. Sein Anlass war zwar Liberia; aber die Frage nach den Aussichten einer militärischen Intervention ist immer dieselbe, wenn das Ziel nicht Machtpolitik oder wirtschaftliche Ausbeutung, sondern Umerziehung heißt. Es gibt nämlich für den Fall, dass sich die Kultur als das wahre Pièce de Résistance erweisen sollte, durchaus ein historisches Muster, wie sie sich erfolgreich bearbeiten lässt. Das ist der Kolonialismus, aber wohlgemerkt nicht der merkantil bestimmte der Engländer oder Holländer, sondern der iberische.
Die Spanier und Portugiesen haben in der Tat Südamerika erfolgreich und restlos in einen Teil ihrer Zivilisation verwandelt. Es hat allerdings einige Jahrhunderte gedauert, und, vor allem: die Idee ging von Anfang auf die Kultur. Es war die christliche Mission. Wir mögen den Vorgang heute skeptisch beurteilen, aber die Kultur-Leistung ist staunenswert. Selbst dort, wo eine Rückbesinnung auf das indianische Erbe einsetzte, geschah sie nur mehr durch die Augen des Westens. Der nostalgische Kult der Azteken wird von den Mexikanern mit der charakteristisch kulturpessimistischen Geste des Spaniers betrieben. In die portugiesische Kolonie Goa mussten die Truppen der indischen Union einmarschieren; freiwillig anschließen wollten sich die katholischen Goanesen nicht.
Der verstockte Süden
Der Katholizismus und das Missionsgebot der Bibel sind entscheidende Stichworte. Denn das Problem, das der Westen beim Export seiner Lebensform hat, hat er vor allem mit Kulturen, denen er seinen Relativismus, das heißt den weltanschaulich gleichgültigen Pluralismus, nicht verkaufen kann, weil sie dazu neigen, bestimmten Werten unbedingte Geltung einzuräumen. Gegenüber solchen Kulturen nützt es nichts, darauf hinzuweisen, dass die Demokratie defekt bleibt, wenn die Religion nicht zur Privatsache erklärt wird.
Die vollständige Verwestlichung ihrer Kolonien konnte den Spaniern und Portugiesen nur gelingen, weil sie mit just dieser Unbedingtheit auftraten. Auch sie sahen keinen kulturellen Spielraum, anders zu verfahren. An dem unbedingten Missionsgebot der Bibel gab es (und gibt es) nichts zu rütteln. Es ist allerdings sehr zu fragen, ob der Westen heute, selbst wenn er bereit wäre, in Liberia, dem Irak oder andernorts den bitteren und historisch belasteten Weg der Kolonialisierung zu gehen (man würde vielleicht von Protektoraten sprechen), diese Energie der Unbedingtheit aufbrächte. Es widerspräche seinem Wesen und übrigens auch dem Sinn seiner Mission, Werte absolut zu setzen; denn das will er ja gerade den verstockten Kulturen der Dritten Welt nahe bringen: dass sie sich zu Toleranz und Pluralismus durchringen. Man könnte fast sagen, der letzte und einzige Wert, den der Westen absolut setzt, besteht in der Forderung, Werte nicht absolut zu setzen.
Das ist das unaufhebbare Paradox, das jede Kolonialisierung in einen Selbstwiderspruch treiben würde, der dem Westen die Legitimation entzöge. Darum wäre die Konsequenz so ungemütlich, wenn nicht die leicht zu exportierenden Faktoren Politik oder Wirtschaft, sondern die Kultur die entscheidende Kraft der Gesellschaft wäre. Man unterstellt den Amerikanern gerne Naivität; aber vieles spricht dafür, dass sie sich für den Politikexport entschieden haben, weil dies noch der harmloseste Weg ist. Denn wahrscheinlich sind nicht Wirtschaft und Politik die Hardware; das härteste Material, das die Menschheit zu bieten hat, ist die Kultur, sind Herkommen, Tradition, Sitten, Hoffnungen, Glauben und Gedanken, die sich weder durch Schwert noch durch Geld widerlegen lassen.
Die Modernisierungskräfte
des Kapitals haben zwar viele Unterschiede in der Welt eingeebnet, aber
keinesfalls alle. Es gehört zu den starken Pointen der Weltgeschichte,
dass jene Länder, die schon einmal, nämlich nach iberischem Muster
umerzogen wurden, heute der Globalisierung der Sitten besonderen Widerstand
entgegensetzen. Kapitalismus und Demokratie herrschen fast überall
in Lateinamerika; aber die Bindungen an Familie und Kirche haben sich nicht
gelockert. Wenn die USA im Irak scheitern, werden sie sich erinnern an
den verstockten Bruder im Süden des Kontinents. „Armes Mexiko, so
fern von Gott und so nahe an den Vereinigten Staaten“, hat der mexikanische
Diktator Porfirio Díaz einmal geklagt. Das war mehr als ein ironisches
Bonmot, vielleicht war es ironisch zuallerletzt. Dem Einfluss der USA hat
sich Mexiko nicht entziehen können, aber die katholische Trauer über
seine Gottesferne konnte ihm von keiner Macht der Welt wegmodernisiert
werden.
© Jens Jessen
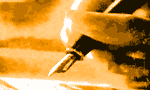 Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
© Jens Jessen
*Mein Dank ![]() gilt Thomas Assheuer und Ruth Viebrock, von DIE ZEIT, die den Kontakt hergestellt
hat.
gilt Thomas Assheuer und Ruth Viebrock, von DIE ZEIT, die den Kontakt hergestellt
hat.